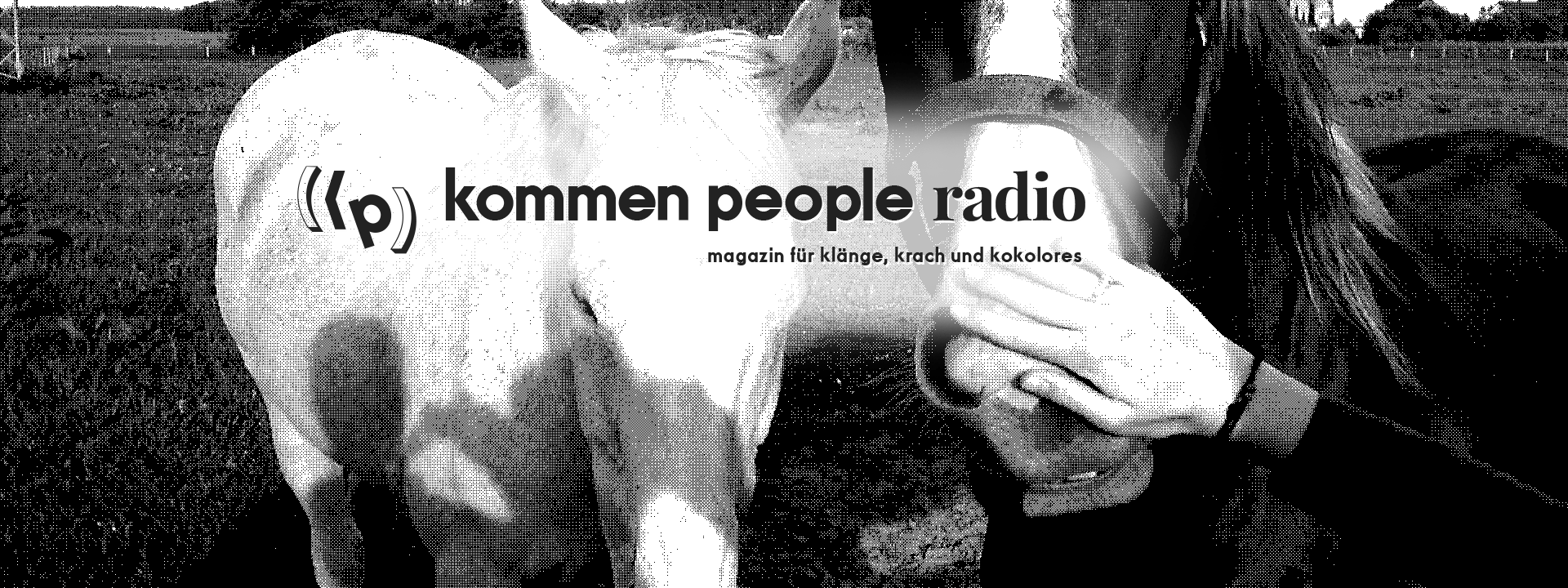Geschätzte Lesezeit: 7 Minuten
Um die Gruppe Mutter herrscht seit Gründung eine Art Kennerkult. Der strahlt so sehr als Mythos aus dem Feuilleton, den Kennergesprächen und den Independent-Zirkeln heraus, dass der Musik von Mutter immer der Eindruck des Sperrigen und Schwierigen vorauseilt. Das ist in dem Sinne schon Quatsch und bigott, da es die Annahme einschließt, das Kennen, das Feuilleton und der Independent seien erstmal irgendwie verquast, schwierig und sperrig. Komische Welt.
Der menschliche Irrsinn und wie man ihm begegnet

Aber so handeln die Menschen nunmal: sie versuchen die Dinge, die sie umgeben in ihre Lebens-, Gemüts- und Gefühlswelten einzuordnen. Ein sehr einfacher Weg ist hierbei etwas im Spiegel von etwas anderem zu sehen, etwas als Abweichung zu deuten. Küchentischphilosophisch weiter gedacht meint das: Die Andersartigkeit, das Anderssein beschäftigt die Menschen. Mal pubertär als Gefühl nicht irgendwohinein zu passen. Dann als etwas, wovor man sich fürchtet, als angstmachendes Unbekanntes. Und ein anderes Mal ist das Anderssein ein Traum – ein Wunsch, ein Ideal, ein Wolkenbruch aus Möglichkeiten, der multimedial und dauernd über den Menschen abregnet. Das bringt manche Menschen an den Rand des Wahnsinns, weil es ihnen die Selbstsortierung und die Identitätsfindung so erschwert. Aus diesen Unsicherheiten in der Sorge um das eigene kleine Scheissglück entstehen bei Menschen Desillusion, Phlegma und ein taubes Gefühl von Ortlosigkeit. Bei anderen Menschen erzeugt es Feindseligkeiten, Hass, Kriege, Mord und Todschlag. Wieder andere lässt das alles kalt oder es gelingt ihnen, mit einem komplizierten System aus Dumpfheit, Ignoranz, Selbstherrlichkeit und Gleichgültigkeit drumherum zu kommen, sich unnötig viele Gedanken über sich und die Welt, die sie umgibt zu machen. Über all das – den menschlichen Irrsinn und wie man ihm begegnet – berichtet die Musik der Gruppe Mutter seit 30 Jahren.
Ihr neues Album vertont in acht Stücken auf 53 Minuten diesen „Traum vom Anderssein“. Mal lieblich, ätherisch als in Shoegaze gewandete Weltdeutungswolken, dann wieder wummernd – nah am Frühwerk der Band – als brüllende, kaputte, alte, saure Hoffnung.
Unscharfer Schwere-Rock
Der Reiz im Werk der Musikgruppe Mutter liegt in der Empfindung einer Unschärfe, die durch die Reibung in der Musik selbst, der Reibung der Musik in ihrem Rezeptionskontext und der Reibung an Erwartungshaltungen entsteht. Anders formuliert: in ihren Songs dröhnt und brettert es mal wie bei den Swans, ein anderes Mal klingelingeln sie sich durch Folk-Pop-Songs über „Freunde und Freundinnen“. Im Feuilleton und den Fach- und Krachzeitschriften werden sie immer irgendwie durchgewunken und gefeiert; alle dort aufgetürmten Schlaubergerberge wissen aber immer auch nicht so richtig wohin mit dieser im Punk wurzelnden, eher unlyrischen, aber doch immer sehr berührenden Musik. Sie wird deshalb zumeist erstmal als hochwichtiges Statement zum Zeitgeist gelesen. Das Fehlen eines doppelten Bodens der Ironie oder einer ausgestellten Künstlichkeit machen es schwer, da leichtfertig über diese letztlich darin doch empfundene Schwere etwas zu sagen. Genau jegliches Fehlen von Unschärfe in Max Müllers Texten lässt das Werk Mutters im Spiegel anderer (deutschsprachiger) Rockmusik so unscharf und schwierig greifbar wirken. Das Schöne ist: in ihren besten Momenten greift diese Musik einen ganz von selbst!
Eigentlich ist bei Mutter nie etwas schwierig. Ihre Musik ist oft schwer, drückend, treibend. Es ist irgendwie Doom-Rock, Noise und rumpelnder Post-Punk. Der Faktor des kolossal Schlepprockigen und Kompromisslosen war bei Mutter immer schon da. Schon der Bandname ist natürlich gewaltig in seiner phonetischen Zierlosigkeit, gepaart mit der Bedeutungstiefe, die in dem Begriff des Mütterlichen (ob handwerklich, biologisch oder familiär) so drin steckt. Es ist in hohem Maße independent, da es sich üblichen Verwertungslogiken des Musikmarktes immer eher verweigerte.
Max Müllers Gesang klingt mal bubenhaft vor sich hin trällernd, ein anderes Mal etwas verschnupft und sehr oft wie ein komplett Kaputtgepeinigter. Wie einer, der sich in inneren Qualen und Zerreissungen windet, der sich selbst aufmacht, sich aufklappt in der Musik, der sich auseinanderzerrt, der zusammenbricht und durch sein brachgelegtes, kaputtgeclustertes Wesen kriecht. Da geht Max Müller dann direkt ran, an den Schmerz, in exzorzistisches Gebrüll, Geschrei, Getöse und Geklage hinein. Danach ist aber auch wieder gut. Dann geht die Band beim Italiener was essen (sehr schön dokumentiert im Dokumentarfilm „Wir waren niemals hier“ über die Band aus dem Jahr 2005) und Max Müller trödelt im Internet und postet launiges Zeug in sein Facebook (sehr schön dokumentiert in seinem Facebook). Der Schmerz ist ja immer da. Der Lärm ist auch immer da. Auch die okayen Seiten des Lebens sind immer da, vergraben und verbuddelt manchmal zwar, aber sie sind da. Auch die ganze olle, laute Welt, die ja alldem – dem Empfinden von ihr und dem Erzählen und Singen darüber – zugrunde liegt, auch die ist immer da. Die Gruppe Mutter kann an all das jederzeit ohne Umwege ran. Es braucht keinen Art-Rock-Überbau, keine gestelzte Attitüdenhaftigkeit und auch keine feste Einsortierbarkeit als Diskurs-Doom-Rock oder in irgendein anderes popkulturelles Korsett, das hinten und vorne nicht hinhauen, oben und unten nicht zugehen würde. Mutter sind aus sich heraus bedeutungsvoll. Klingt komisch, ist aber ernst. Das kann verwirrend sein, in diesen postmodernen Zeiten. Mutter halten die Augen immer in alle Richtungen offen.
Der Traum vom Anderssein
Auch ihr neues Album verwehrt sich natürlich erstmal dem Anschein zeigefingernd bedeutungsvoll zu sein. Und doch geht es — dem Albumnamen „Der Traum vom Anderssein“ gemäß — textlich an aktuelle, gesellschaftliche Phänomene heran. Es geht um Identitätssuche und die Angst vor dem Fremden und der eigenen Vergänglichkeit. Und welche Blüten diese Ängste treiben. Es geht um Internettrolls und Anhänger von Verschwörungstheorien, um strebsame Leute und um lächerliche Männer „mit sehr viel Macht“. In Letztgenannte lässt sich ebenso ein Verweis auf den Präsidenten der Vereinigten Twitter-Staaten, Donald Trump, als auch die gute alte „Ich-will-nicht-werden-was-mein-Alter-ist“-Abscheu gegen bierzufriedene Eigenheimväter, die in ihren Wohnstuben das Patriarchat im Privaten durchboxen, hineinlesen.
Und es geht auf „Der Traum vom Anderssein“ darum, wie glücklich die Einfalt machen kann. Das Leben ist vielfältig. Heutzutage sowieso. Die Vielfältigkeit tritt unmittelbarer an einen heran. Weil das kompliziert werden kann, sich darin zurechtzufinden, flüchten sich viele Menschen in die einfältigen Bezirke von geistigen Schutzzonen – in Kokons, ummantelt von Aggression, Ausschluss und fieser Blödheit. Das ist nichts Neues und das ist deswegen natürlich immer noch schlimm und dem ist folgerichtig mit Argwohn, Grimm und Ärger zu begegnen. Das macht Mutter als Musikgruppe.
Das erste Stück, „Glauben nicht wissen“, beginnt temporeich und schiebt sich druckvoll in ein dichtes Unbehagen hinein. Müllers Stimme wird da als Sample irgendwie reingebaut, huscht da so herum, als Fragment. Eine doors-artig kreiselnde Orgelfigur unterstreicht den treibenden Charakter. Die fuzzreich verzerrten Gitarren sind warm und shoegazig. Müllers Gesangsbruchstücke tauchen immer mal wieder, begleitet von megaphonischem Rauschen, irgendwo in dem dichten Shoegazesound auf. Manchmal als vokale Einwürfe, als düstere Wortfetzen, die – stilistisch entfernt, aber stimmungsmäßig nah dran – an das psychotische Rockabilly-Gejaul eines Alan Vega denken lassen; mindestens eine ebenso düstere Beklemmung erzeugen. Man versteht wenig von Müllers Text, nur, dass aus irgendetwas – wahrscheinlich dem „Glauben nicht wissen“ des Titelnamens – „noch nie etwas gutes draus entstanden“ sei.
Die Gitarrensoli schreddern ordentlich im Stereoraum. Hier geht der Rock in den Noise. Kein Altherrengerocke, sondern mehr so Sonic Youth. Thurston Moore von Sonic Youth hochlobte das Gitarrenspiel der Vorgänger-Gruppe Campingsex als wesentlichen Einfluss auf Sonic Youth.
Produzent Dirk Dresselhaus alias Schneider TM setzt den ganzen Lärm auf „Der Traum vom Anderssein“ dicht und brummend, gelegentlich mit Autotune-Effekten ins krautige hineinfrickelnd, in Szene. Die Distortions sind breit, warm und druckvoll. Die Arrangements eher auf ein Vorwärtswehen und Steigerung und Verdichtung angelegt.
Sommertage im Park und Grotesken der Sinnfindung
„Menschen Werden Alt Und Dann Sterben Sie“ ist so eine klassische Mutter-Nummer, die sich erst biestig aufbäumt und dann bleiern voranschleppt. Blechreiches Geschüttel an den Drums, grollende Gitarren, auf deren Saiten man slidet und bendet, bis das Biest eventuell gebändigt wird. Wird es aber nicht. Nach drei Minuten hievt sich dieser Zeitlupen-Freakout in ein schleppendes Monster mit Sludge-Schlagzeug hinein. Müllers Vocals stehen echotisch irgendwo in dem Monster drin und rufen in die nackte Wand des wilden Lärms. Das ist – wir haben es mit einem muttertypisch bedeutungsvoll-unterkomplexen Liednamen zu tun – natürlich existentialistisch, nah an so einer Art allgemeingültigem Bauchgefühl einer menschlichen Individualexistenz im Schatten ihrer eigenen Vergänglichkeit. Vielleicht etwas ernüchternd, vielleicht etwas bedröhlich, aber in jedem Fall – wie Max Müller eben immer so singt, als sänge er von einem schönen Sommertag im Park oder den Grotesken des sinnlos suchenden Sinnfindungswahns – erstmal absolut richtig und real.

Max Müller spiegelt in seinen chiffrenlosen Texten immer schon die vergrabene Schönheit und die Farcehaftigkeiten der Welt, die ihn umgibt. Er singt vom Perversen und den Umständen, die das Perverse erst als pervers definieren. Er agiert nicht als Ich-Sänger, der den ätherischen Dusel seiner wilden Künstlerseele in lyrische Verdichtungen zu packen versucht. Er bewertet nicht. Er besingt, was er so sieht – wie er und wie andere leben. Er schildert Sichtweisen. Auch die Musik holt aus einem rockmusikalisch grundsätzlich gewöhnlichen Ansatz ein Maximum an Direktheit heraus. Aus der Abwesenheit von Affektiertheit entsteht bei Mutter Unmittelbarkeit.
Die Sprache löst sich hier zuweilen bis zur Unverständlichkeit im schönen Lärm der Musik auf. Das war schon auf früheren Alben von Mutter so. Neu ist jetzt die Verwendung von Autotune-Spielereien. In „So bist Du“ wird die titelgebende Sentenz zum Mantra, bis sie klingt wie eine wortferne Formel.
Das Stück wird eingeleitet von einem absteigenden Basslauf, dessen kissenhafte Sänfte von einem hallreichen Schlagzeug ausgepolstert wird. Die Gitarren stehen, wehen und dengeln verzärtelt und dicht umeinander herum. Max Müller singt von einer Person, die „dir die Geschichten“ erzählt, „die du dir anhörst und irgendetwas stimmt immer nicht darin“. Es geht hier um einen dieser traurigen Trampel, die sich in eine Verschwörungstheorie flüchten, „von der keiner weiß, ob es so gewesen ist“, um jene Leute, die, „jede kleine Gewissheit, es könnte so gewesen sein“ froh macht. Um jene Leute, die sich ihre Welt und ihre Politik aus Google-Suchergebnisbrocken zusammenschustern.
Max Müller fragt sich im weiteren Text „wieso soll ich ihm sagen, dass er lügt // wenn er so glücklich damit ist?“. Soll man also den hysterischen Hitzköpfen, von denen jeder ja irgendwie (Grundschulfreunde, Arbeitskollegen) dann doch jemanden in seinen digital-sozialen Netzwerken kennt, mit Vernunft und Versuchen des Dialogs begegnen oder soll man solche Gemüter einfach in der Suppe ihres kleinen, schlichten, blindwütigen Glücks planschen lassen? Und geht es nicht am Ende sowieso nur um das, was man darin liest? Und sind wir nicht alle letztlich auf der Suche nach irgendeiner standhaften Gewissheit? All diese Fragen stellt Max Müller nicht, aber sie scheinen hinter seinen Worten auf. Von daher ist auch „Der Traum vom Anderssein“ natürlich wieder ein hochwichtiges Statement zum Zeitgeist, klar.

Ein Piano greift den hymnischen Basslauf von „So bist Du“ wieder auf. Das Schlagzeug zischelt, und scheppert, alles steigert sich im hinteren Drittel in gleissenden Shoegaze. Sollte da hinten, am Ende dieses lärmenden Tunnels vielleicht ein Licht, vielleicht sogar etwas wie Vernunft oder ein ähnlich wertiges Hilfsmittel für ein harmonisches Miteinander all der Träume vom Anderssein sein?
Glockige Wall-of-Sounds
Manchmal, wie im Titelstück „Der Traum vom Anderssein“ klingt Mutter hier, in melancholisch gedämpftem, heiteren Vorwärtswandern wie Dinosaur Jr., in den ruhigen Momenten, wie dem balladesken „Fremd“ denkt man an ihr legendäres, 1993 erschienenes Nicht-Krach-Album „Hauptsache Musik“ und an die – zur gleichen Zeit erschienenen – Alben der Flowerpornoes . Wenn sich „Fremd“ am Ende dann in einer glockigen Wall-of-Sound ergeht, getragen von einem kurbelnden Bassmotiv und stoischen Klaviersätzen, denkt man an „Verstärker“ von Blumfeld und jene schillernden Live-Versionen, die sie davon in ihrer Spätphase gern spielten.
Blumfeld waren im Verhältnis zu Mutter damals sowas wie das Gegenteil mit selben Vorzeichen. Jochen Distelmeyers ziselisierte Worte haben – hat man sie erstmal auseinandergefaltet – eine ähnliche, gesellschaftsreflektierende Stoßrichtung wie die Texte Max Müllers: man kann hier schon von Humanismus und Moral sprechen.
In den düsteren Nummern dominiert kein Zynismus, kein Hass und keine Verachtung, sondern pure Empörung, Wut und Bedauern. Und die Vermutung, dass es irgendwie doch noch etwas Besseres vielleicht gibt, etwas anderes, von dem es sich zu träumen lohnt oder das Traumthemengeber für die Menschen sein kann, worüber Max Müller dann sinnieren mag. „Der Traum vom Anderssein“ ist also etwas, das die Menschen kaputt, mürbe, unentschlossen und irre macht, sie innerlich und zwischenmenschlich entzweit. Der Traum vom Anderssein meint aber auch eine Hoffnung, einen Traum, dass es noch was anderes gibt, als riesengroßen Scheiss. Vielleicht.
Mutter ist, ähnlich wie das Caspar Brötzmann Massaker, eine Band, die manchmal sogar Friedlichkeit im Lärm findet, sich ausdrückt in Druck. In der Verausgabung in krachgewordenem Zweifeln dringt man schlussendlich vielleicht irgendwann zu so einer Art Ruhe und Ausgeglichenheit hindurch, zu etwas Freundlichem, vielleicht sogar Befriedigendem. Krach als Heilung.
Rocken im Anti-Rockistischen
Das überbordende Rocken im Anti-Rockistischen war schon immer ein Mehrwert bei Mutter. Wo die ganzen Männerrockbands ihre Songs am Ende mit bisschen Aftermath und Freakout effektreich beenden, fangen Mutter erst an. Sie gehen richtig rein, in den Sog der Kaputtheit, in den Krach, in den Schluckaufschreck der die Menschen, aus ihrem Traum vom Anderssein rausreisst (oder sie aus irgendeinem Geistesblitz heraus unversehens dort hineinwirft) und sie verdrossen, einsam, und in ihrer manischen Strebsamkeit dumm macht. Ja, Mutter sind mit ihrem Dröhnen das Gefühlssprachrohr von uns kleinen Leuten mit den großen Herzen und den Tinnitusohren. Von den kleinen, dauerbeleidigten, dauerdeutschen, dauerdoofen Leuten mit den verschrumpelten Hassherzen handeln die Stücke auf „Der Traum vom Anderssein“.
Insgesamt knüpft „Der Traum vom Anderssein“ mit seinen Spezialeffektspielereien, dem satten Sound und dem Willen zum warmen Wummern, der sich hier und da für leisere Töne zurücknimmt, an ihr 2001 erschienenes Album „Europa gegen Amerika“ an. In diesen 53 Minuten schaffen es Mutter wieder, konkrete Dinge über das Leben und jene letztlich darin doch empfundene Schwere zu sagen.