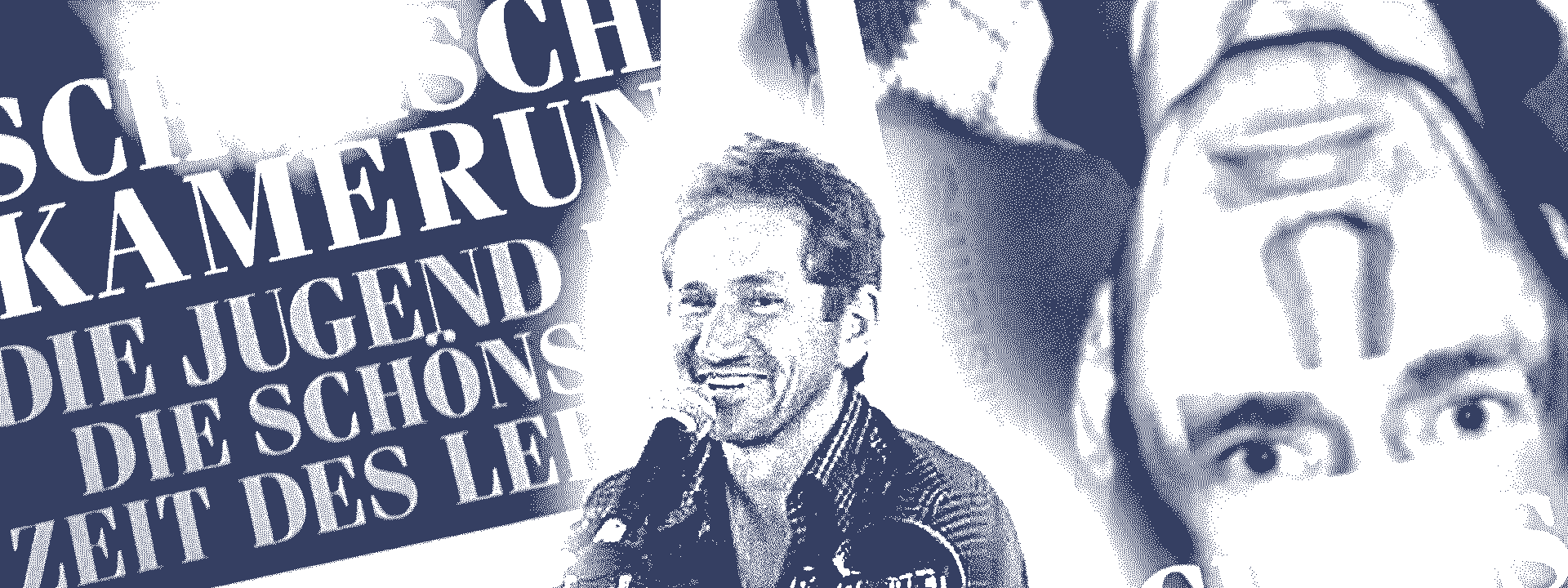Ich war in den mittleren Neunzigern noch zu jung für ein Szeneleben, das ich mir – am Rande von der Stadt wohnend – so im Inneren von Berlin ausmalte. Neben dem üblichen Jungs-Indierock prägten die dort wurzelnden Songs der Lassie Singers und der danach folgenden, altersmilderen, ebenfalls die Texte von Christiane Rösinger vertonenden Band Britta maßgeblich meine eventuell natürlich juvenil-romantisierten Ideen, wie es da wohl zugehen muss, „so bohemy in crazy Berlin“ (Britta, 1999).
„Zu blöd für jedes kleine Glück“
Ich glaubte mich noch eine gute Weile zu jung, zu unhip und zu unsicher für den coolen Szenescheiss. Mit 15 fuhr ich immerhin – innerlich komplett versaut schon und natürlich völlig verstanden durch das Frühwerk von Tocotronic, aber auch angetan von den balladesken Erbauungsstücken von Ton Steine Scherben und Rio Reiser – mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die coolen Kieze vom Prenzlauer Berg und Friedrichshain, um mir Cord-Schlaghosen zu kaufen. Ich bewegte mich ungelenk und wie der letzte Blödian durch das Getriebe der Großstadt. Ich fand es seltsam anheimelnd, wenn mir die warme, stickige Luft aus den Schluchten der U-Bahnhöfe durch meine asymmetrisch gescheitelte Frisur pfiff, die meine Friseurin im Dorf eher als Frauenschnitt verlachte.

Irgendwo hier, in der City, in den Gassen, Bars, Ateliers und Kleinclubs muss wohl das Szeneleben stattfinden dachte ich mir, wo gut, originell oder wenigstens interessant angezogene Leute, mit einem von mir beneideten Altersvorsprung (mir waren als Kind meine Altersgenossen schon immer irgendwie zu kindisch), ihre Version eines alternativen Lifestyles lebten. Ich traute mich da noch nicht rein, fühlte mich zu jugendlich, zu ahnungslos, zu traurig, tendentiell zu allein für Ausgehleben und schlaue Gespräche in der Nacht, kurz gesagt: „zu blöd für jedes kleine Glück“ (Lassie Singers, 1996 bzw. Britta, 1999).
„Menschen gehen mir auf die Nerven, meine Freunde sowieso“
Etwa zur ähnlichen Zeit, hörte ich die Lassie Singers, Andreas Dorau und die Pop Tarts im Radio, fuhr zum Saturn und kaufte mir die entsprechenden CDs (die es damals im Gegensatz zu heute auch in solchen Großhandelsketten alle gab). Zu den coolen Plattenläden traute ich mich nicht, weil ich Sorge trug, man könnte mich ertappen – als, was das In-Scene-Sein betrifft, komplett ungeweihtes Kind vom Lande. Die sich bei mir im Jugendzimmer stapelnden Musiken vermischten sich zu einem melancholischen Grundsummen, das ich von da an immer in mir trug. Als Ohrwürmer und Textzeilen, die mir auch heute noch – wo ich größtenteils nur noch Musik höre, die wie brummende Kühlschränke und kaputte Tonbänder klingt – immer wieder in den Sinn kommen und dort wie liebe Hausgäste durch die Hirnstube tigern.
Klar hörte ich auch die ganzen Sachen aus der Hamburger Schule, fühlte mich da prinzipiell auch verstanden, wähnte aber sogar auch dort – geschunden durch allgemeinen Jungskram wie Sportunterricht und Klassenfahrten – potentiell jungsbündlerische, klüngelartige Strukturen. Mir waren rockende und ungefragt losdozierende Jungs irgendwie dann doch ein bisschen zu laut, zu vorauspreschend, final gar nicht so weit weg von den mitteilungswütigen Meinungsmachern und den groben Prolls, die man vom Schulhof her kannte. Ironisch, und vielleicht ungerecht dem aufklärerischen Gestus von Diskurs-Pop gegenüber, aber so empfand ich es zuweilen.
Manchmal geht einem eben auch die eigene Familie auf den Senkel. Britta sangen später, in 2006: „Menschen gehen mir auf die Nerven, meine Freunde sowieso“, nur um dann – ganz ohne zu dozieren auf Molière verweisend – nachzuschieben: „Entschuldigung, Entschuldigung, ich hab’s nicht so gemeint // Es ist nur so, ich bin seit heute: Menschenfeind!“.

Die Lassie Singers und noch viel mehr später Britta, sangen immer von den Dingen, die ich verstand: Melancholie, emotionaler Wankelmut und Prekariat; Ausgehen oder auch mal Zuhausebleiben und „sinnlos runter auf die Straße sehen“ (Britta, 2006). Das prekäre Nachtleben wurde naturgemäß erst in meiner Adoleszenz, mit eigener Wohnung und eigenen Ideen, wie man die tristen Katertage auch mal hinter vernieselten Fenstern verbringen könnte, wirklich relevant. Die bleierne Melancholie aber war schon als Kind mein freundlicher Begleiter. Mir waren meine Altersgenossen manchmal dann doch etwas zu grundlos fröhlich.
Rock Me In Crazy Berlin
Anfang der 2000er saß ich dann – wahrscheinlich immer noch in Cordhose, die Erinnerungen verschwimmen – in der ersten Niederlassung der NBI damals, Schönhauser Allee. Der DJ spielte irgendwelches Minimalgeklicker und ich saß latent deplaziert, aber von einem heimeligen Gefühl wie angewurzelt im weichen Gefüge der hippen Sperrmüll-Sessel, sah für Berliner Verhältnisse (oder das was ich dafür hielt) wahrscheinlich bisschen verkleidet aus, und fühlte mich super – etwas ungeschickt mit den Gesten und Gepflogenheiten des Ausgehlebens noch; aber es lebte sich gut in diesen Räumen des Dazwischenseins. Mehr als im Halbdunkel rumsitzen und ab und an was reden brauchte ich als Amusement ja sowieso nie. Tanzen ging ich eh nie richtig, weil ich das eine Weile lang eher für ein verkrampftes Werkzeug zwischenmenschlicher Annäherung hielt. Für schlau am Rand rumstehen fühlte ich mich aber dann wieder auch zu wenig wie Diedrich Diederichsen. Kurz gesagt: ich war verkapselt in den Unsicherheiten der Post-Pubertät. Das Ausgehen immerhin half mir, nicht sozial komplett zu verschrullen. Ich war damals knapp zu jung für Fischbüro, die Ur-Flittchenbar, Ex und Pop und Galerie BerlinTokyo – alles Orte, mit denen Christiane Rösinger, Sängern von Britta, irgendwie verbandelt war.

Immerhin, ich konnte ganz gut nachvollziehen, was Britta meinten, als sie von den „traurigsten Menschen in ganz Berlin“ (Britta, 2001) sangen. Das war genau die Art Hedonismus und Verweigerung an der Leistungsgesellschaft, die mir lag. Das war mir näher als schillerndes Nightlife und stundenlang an irgendwelchen Clubs anzustehen. Das verstand ich eher als so manches Geschwafel in der Spex (die ich mir mit meiner Dorffrisur am Dorfbahnhofskiosk natürlich zu allem Übel auch zu kaufen pflegte).
Irgendwann wurde ich natürlich etwas schlauer und verstand, dass es nicht um Gesten oder Gepflogenheiten oder Diedrich-Diederichsen-Expertise geht und dass die in der Spex oft auch nur mit Proseminarswasser kochen. Im Gegenteil, mir wurde in meinen trüben Wässern des melancholischen Dahinsumpfens über die Jahre klarer: das Ausgehen sollte eigentlich genau das Weggehen von Daseinszwängen und Individualitätsdrangsal sein – ein zweites Wohnzimmer, durch das man so die nächtlichen Stunden schleicht, wo alle kollektiv ihre Zeit verschwenden und dabei natürlich unbezahlbare Gewinne einfahren – emotional, ideell, kreativ, lebensideenplanerisch; wo man sich zwar auch scheinbar schlaues Proseminargesaftel um die Ohren haut, am Ende aber sogar der beschlagenste Spex-Abonnent da dann besoffen mit seinem schicken Scheitel vom Stuhl fällt, wie ein nasser Sack.
Und dieses Leben, zwischen Spex auf dem Klo zu liegen haben und sich, mit der innerlichen Schwere eines nassen Sackes, durch sein eigenes Leben zu hieven – über diesen Dunstkreis sangen Britta immer. In so einem Leben bin ich über die Jahre dann folgerichtig gelandet (mir war als Kind die Vorstellung schon suspekt, irgendwann täglich für acht Stunden zu einer Arbeitsstelle gehen zu müssen, die mit mir und meinen unscharf definierten Kernkompetenzen nur wenig zu tun hat). Manchmal fehlte das Geld sogar, um eine Spex zu kaufen, aber die CDs von Britta, wenn mal eine neue kam, sparte ich mir gern von meinem Bafög oder irgendwelchen Brotjobs ab.
Lamentierlieder für die Teilaspekte des Lebens
Und natürlich sangen Britta auch immer über die Liebe, die bei ihnen als Songname nur chiffriert als „L****“ notiert wird, zu der ich als Jugendlicher auch nie so richtig Zugang fand, weil mir auch dieses Getändel darum wie aufgebauschtes Geputer, ja geradezu oft wie wirre Verzweiflungstaten erschien. Am Ende ist zumindest diesbezüglich alles nochmal gut gegangen. Aber doch sind all die Tölpeleien und Stolpersteine, die mit diesem Themenkomplex zusammen hängen, ein zentrales Thema in den Texten von Christiane Rösinger, hauptsächliche Sängerin der Band. Über dieses Thema – quasi die Weiterdenkung der „Pärchenlüge“, über die schon die Lassie Singers sangen – um den Kerngedanken, dass Liebe „oft überbewertet“ wird, herum, rezipiert man auch Rösingers Wirken als Solosängerin und Schriftstellerin. Am Ende aber ist auch sie, „die alte blöde Kuh“ (Britta, 2006), diese L**** nur ein „Teilaspekt des Lebens, und die anderen Teile sind auch nicht schleeecht“ (Lassie Singers, 1996).
Und die Summe all dieser einzelen Teile ist dann eben „Das schöne Leben“ – so nannten Britta ihr erstes Album nach dem Tod von Namensgeberin und Gründungsmitglied Britta Neander. Diese ebenso lyrische, wie unaffektierte Sichtweise auf das Leben und das Singen darüber ist das andernorts unerreichte Talent von Britta als Band und Christiane Rösinger als Songschreiberin. Aber auch Julie Miess, Bassistin und drittes Urgestein der Band, schrieb ein paar Texte – über Kakteenhäuser und Katzen zum Beispiel.
Mit den Alben kamen dann noch Rike Schuberty (Contriva), Barbara Wagner (Wagner & Pohl, Popchor Berlin) und Sebastian Vogel (Kante) hinzu. Allesamt von Gitarren-Electronica bis elegischem Diskurs-Pop beschlagene Musikmachende, die in den 2000ern überall ihre Hände mit im Spiel hatten.
Superseufzerhits für Thirty+-Somethings
Jetzt erscheint ein „Best Of“ von Britta bei Staatsakt. Britta singen darauf gesammelt und weiterhin von den Errungenschaften und Nöten, Mangel- und Verzichtserscheinungen eines selbstbestimmten, sogenannt alternativen Lebens. In jedem Fall singen sie nicht vom Kopf und der Frisur, sondern mehr vom Herz und der müden Seele her und haben damit jede gut ondulierte Indieboyband und jeden neu-berlinischen Lifestyle-Spleen über die Jahre schlichtweg überlebt.
Die Lieder von Britta sind befreiende Seufzer, sie sind die lässig übers gekreuzte Knie hängenden Hände, die lakonisch alles Unbill und allen wirren Lärm der Welt, der ja nie aufhört, auch im Älterwerden nicht, abzuwinken im Stande sind.
Ihr Best Of enthält alle Superseufzerhits von „Depressiver Tag“ bis „Ich bin zwei Öltanks“. Thematisch geht es immer auch um Aufstand und Revolte, es geht um die Empfindungen von Ungerechtigkeit und Zwängen der Leistungsgesellschaft. „Wer schon hat, dem wird gegeben. Und für uns bleibt nur das schöne Leben“ heisst es in „Wer wird Millionär“ von 2006. Was unter den falschen Händen wie ein „Wir steigern das Bruttosozialprodukt“-Gassenhauer klingen könnte, wird bei Britta, gerade mit dem Querverweis auf das schöne (und nicht geile, coole oder nice) Leben zu einer grundgü(l)tigen Wahrheit über das Leben zwischen Prekariat und kieziger Bürgerlichkeit – die Grenzen sind da ja fließend.
Es geht bei Britta auch um Müdigkeit und Melancholie, um milde, unschrille, bereichernde Formen des Geselligseins, die man nachts, in den Orten des Ausgehlebens, fern vom eitlen Gegockel in den Clubbingkontexten, so finden kann. Britta besingen all das aus dem angenehm leistungs-und posendruckbefreiten Blickwinkel von Thirtysomethings und aufwärts.
Vieles wird mit dem Älterwerden eigentlich einfacher, besonders wenn man endlich diese lästige Selbstfindungsphase zwischen 15 und 30 einigermaßen über die Runden gebracht bzw. einfach zu den Akten gelegt hat, weil es ja eh nichts bringt, man ist ja immer – wenn man morgens die müden Hundeaugen aufmacht – man selbst, punktaus. Die Frage, wie man Leben will stellt sich nicht mehr als existentielle Sinnfrage, sondern wird täglich als Antwort neu gelebt und eher fragt man sich dann dabei: „ist das noch Bohème oder schon die Unterschicht“ (Britta, 2006).
Parole Potemkin, Baby
Irgendwann begannen die Menschen um mich herum immer mehr ein richtiges Leben zu führen, sie spielten „Büro Büro“, hatten gut bezahlte „Projekte“, deckten „sich mit Arbeit ein, die’s gar nicht gibt“ (Britta, 2006). Ich fand das beeindruckend, bemerkenswert und finanziell natürlich beneidenswert. Ich jobbte mich von Brotjob zu Brotjob und kam auch irgendwie über die Runden. Das wird mit dem Älterwerden alles nicht romantischer, „aber wir sind nie sentimental, es war ok, es war ja unsere Wahl“ (Britta, 1999).

Britta und die Lassie Singers begleiteten mich also schon ziemlich früh, sangen damals von dem Leben der junggebliebenen Erwachsenen, wie ich es mir als seelisch früherwachsener, frühvermelancholisierter junger Mensch halt so ausmalte und begleiteten mich bis heute – wo ich auch nur das undeutliche Abziehbild eines Erwachsenen und immer noch kein Experte bin, ein Leben wie richtige Leute zu führen … aber eben auch gar nicht mehr den Leidensdruck in diese Richtung habe.
Errungenschaften und Verzichtserscheinungen im selbstbestimmten Leben
Musikalisch nimmt man Britta schon indierockmäßig auf eine Art wahr. Aber es ist hier kein quengelndes Gedengel oder zweckverbundenes Gitarrengeschrammel, niemals in Laut-Leise-Masche verfallend, eher schon balladesk vom Grundgemüt her. Tobias Levin, viel gefeierter Produzent mit Hang zu schillernden Einsprengseln, hatte schon auf dem ersten Album 1999 mitgewirkt. Es fehlt an nichts in der Musik von Britta, sie ist bei allem Indierockartigsein (und wir können hier gern auch mal an die Breeders denken), immer ausgewogen, fast schon in sich ruhend, ohne beliebig und meinungslos zu sein. Tasteninstrumente und Streicher gibt es. Sie sind stets in unaufgeregte Arrangements eingebunden, wie sie auch Lou Reed geschrieben hätte. Es sind bei allem Gewicht, das man den Texten beimisst, keine durchgeklampften 3-Akkorde-Songs, die hier und da mit musikalischen Extras verziert sind, sondern letztlich wunderschön gemachte Lamentierlieder. Die Musik ist hier elementar verschmolzen mit dem was, wie und worüber gesungen wird und ist daher so nah am Songwritertum, wie eben auch die späten, nüchtern betrachtet ziemlich überproduzierten Songs von Rio Reiser waren. Der Song ist mal „just another Happy Song“ (Britta, 2003), ein anderes Mal gar eine vertonte Dichtung von Heinrich Heine.

Unter Brittas Fittiche klingen dann sogar so mächtige, in geschlepptem Schritt vorgetragene Zeilen wie „denn Du glaubst jetzt, an die Liebe // doch sie glaubt nicht mehr an dich“ am Ende doch noch hoffnungsvoll und nicht verbittert. Hier gilt so eine Art musische Grundregel: die Bitterkeit wird unter der lyrischen Lupe etwas erträglicher. Im Singen darüber ist alles eh nicht mehr ganz so arg.
Bleibt zu hoffen, dass es, nach dem „Best Of“ nun vielleicht bald ein neues Album gibt, denn eines haben Britta in ihrem nun zwanzigjährigen Bestehen (die Lassie Singers nicht eingerechnet) bewiesen: es gibt immer was zu sagen, irgendwas ist schließlich immer, das Mühsal wird Routine und damit bewältigbar und manchmal ist das Mühsal sowieso gar nicht so arg schlimm, sondern nur die kleine Kümmernis im täglichen Tun, vieles sind letztlich auch „Probleme, die andere gern hätten“ (Britta, 2001). Denn eigentlich ist es ja immer wieder – jedes Jahr auf’s Neue – so: man kommt vom „Winterschlaf in die Frühjahrsmüdigkeit // Von der Frühjahrsmüdigkeit ins Sommerloch“, man kommt „vom Sommerloch in die Herbsttraurigkeit // In den Winterschlaf // Und zwischendurch gab’s Momente // die war’n gut“ – sangen Britta auf ihrem ersten Album „Kollektion Gold“ ausgerechnet auf einem Stück, das auf dem „Best Of“ nicht enthalten ist.
Aber bei Britta war eh schon immer alles „Best Of“, nur hat das die Mehrheit nie mitbekommen und Britta hatten es nie nötig das so herauszuposaunen. Diese Eleganz, die wie beiläufig entsteht, erinnert schlussendlich auch an die späteren, für ihre Poppigkeit ausgeschimpften Velvet Underground – aber das führt jetzt vielleicht dann doch ziemlich weit und man müsste hierüber mal ein Proseminar abhalten. Vorher vielleicht nochmal zum Friseur und eine Spex für den Fenstersims auf dem Klo. Dann lebt es sich auch in 2018 ganz okay in diesem emotionalen Bohème-Bällebad, durch das man täglich taucht.