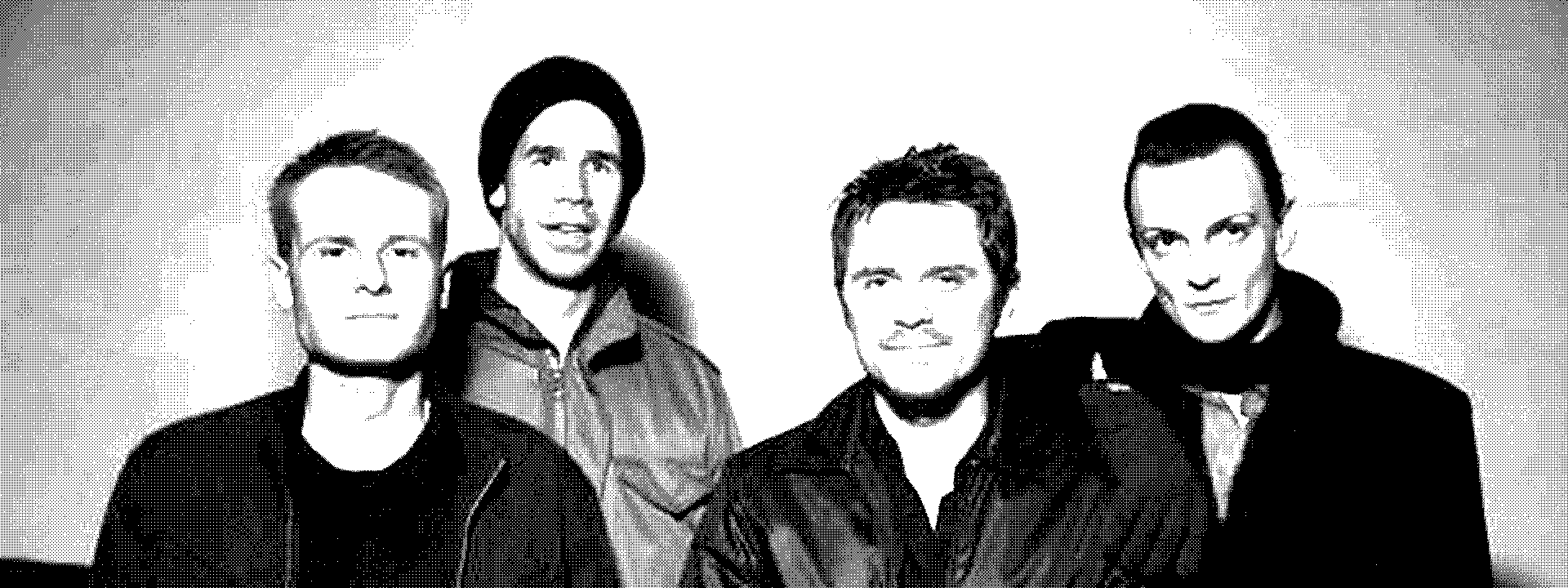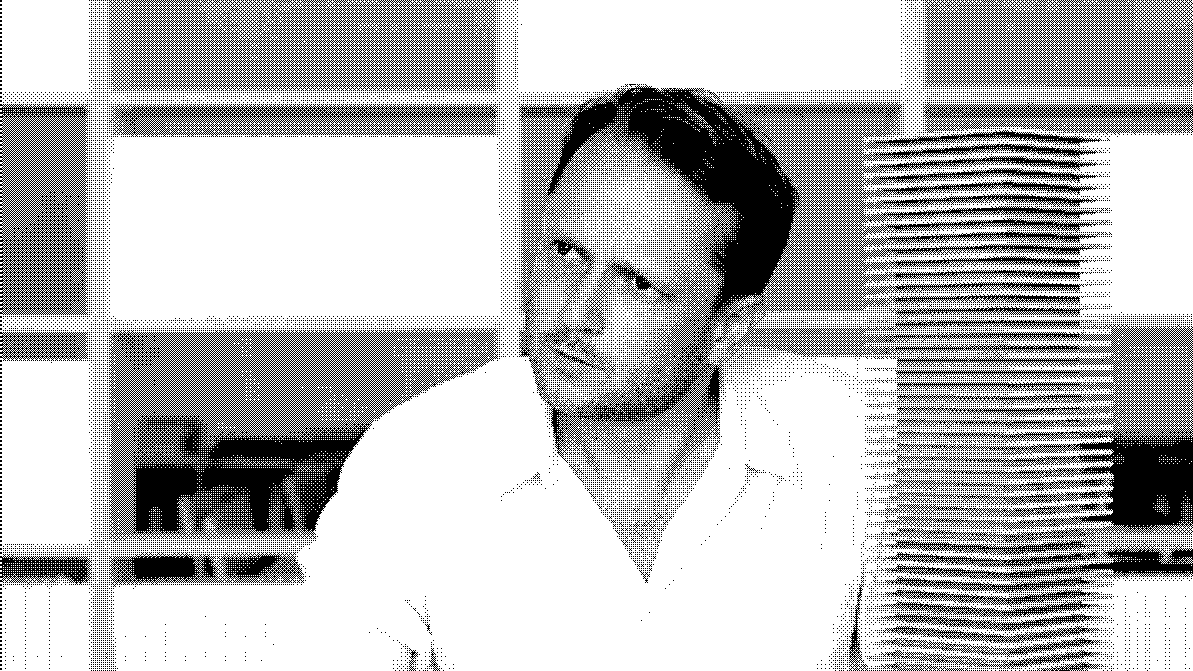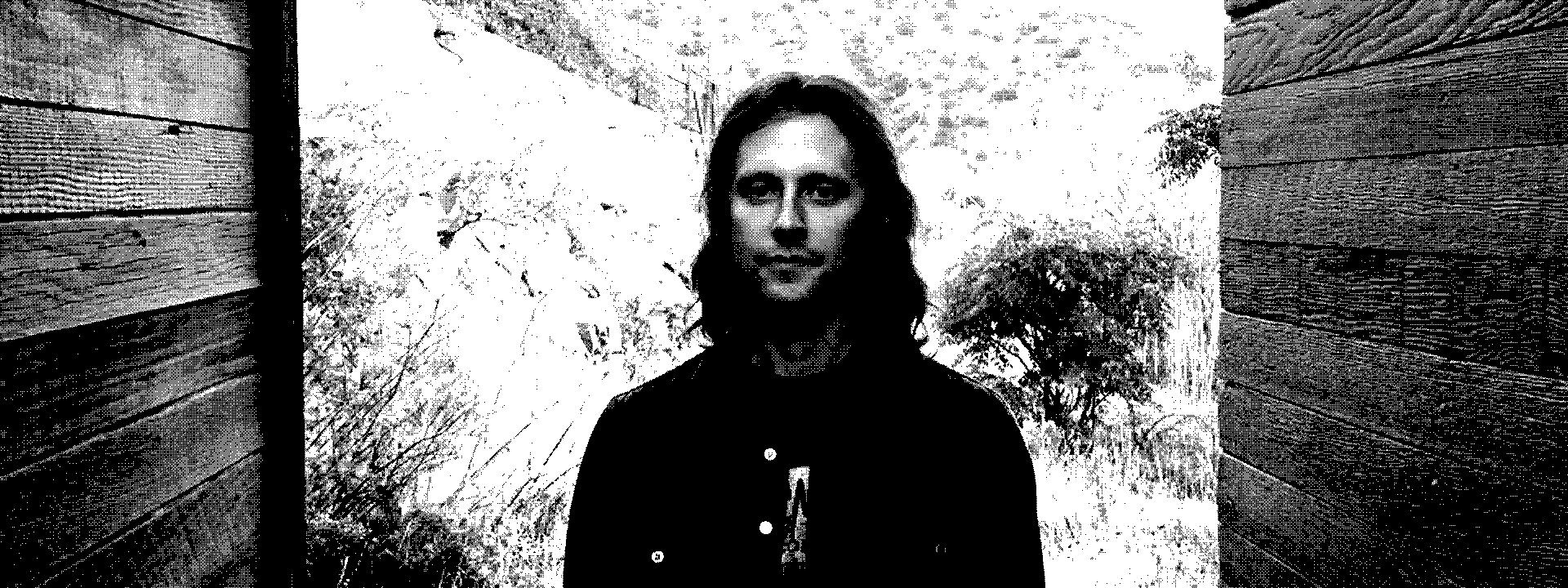Das Popmusikgeschäft ist oft, und genau natürlich deswegen weil es ein Geschäft ist, ein ungerechtes. Manche Bands schaffen es mit ihrer Kauzigkeit, wenn auch oft nur kurz, Oberwasser zu bekommen und schwimmen dann eine Weile auf einem kleinen Hype. Die Kauzigkeit wird als Sonderlingsbonus gehandelt und für eine gewisse Zeit von allen Seiten hoch goutiert. Danach verschwinden diese Kauzbands oft wieder.
Ähnlich ist es Tarnation Street aus Schweden ergangen. Ihr im November 2007 beim längst nicht mehr existierenden Label Lobotom Records erschienenes Album „High Hopes“ gibt es heute kaum noch zu kaufen. Auch das Internet weiss von der Band nicht allzu viel.
Jaulen durchs strudelnde Gefüge der Gefühle

Der erwähnte Kauzfaktor bei Tarnation Street liegt im Gesang von Tomas Wächtler. Er jault und brüllt wie ein heiserer Hund über ein tendentiell gesittetes, musikalisches Gerüst. Die Melodien sind eingängig. Klavierakkorde werden großgestig in den holzgetäfelten Raum geworfen; andernorts sacht getupft. Die Stücke sind mal barloungig gedämpft, dann wieder uplifting, aber auf eine verdrehte Art – wie bei den Mountain Goats.
Es steckt hier eine theatralische Hingabe im Gesang. Sein Jaulen geht durchs ganze Album. Tomas Wächtler singt die ganze Zeit, als bräche gleich alles aus, in eine, von Fanfaren und nikotinierter Heiserkeit befeierte, frenetische Bejahung von Depression, innerer Kaputtheit und anderen Stolperstricken so eines zu meisternden Lebens. Doch genau das passiert nicht. Es brüllt und jault einfach die ganzen 13 Stücke des Albums lang konsequent durch. Nichts bricht aus. Genau das entwickelt einen ganz eigenen Charme und eine ernste Art der tristen Feierlichkeit. Der Sänger bleibt hier immer nah am Kern seiner zu besingenden, jauligen, taumelnden Seele. Er umrundet sie, beschwört sie, setzt sich mit ihr und damit sich selbst auseinander – und findet über diese schnurgerade Strecke des Schwermuts letztlich vielleicht doch sowas wie Halt und Anker im strudelnden Gefüge seiner Gefühle.
In den vorwärtspreschenden Momenten lässt das an Clap Your Hands Say Yeah denken, die ebenfalls ihr Trademark in der wundervoll sonderbaren Stimme des Sängers trugen. Die eher aufgeräumte Musik von Tarnation Street hat ihre Wurzeln jedoch im Klavier. Das lässt dann mehr an Daniel Knox oder an einen irre gewordenen Billy Joel denken.
High Hopes in der Popsumpf-Versenkung
Die Stücke auf „High Hopes“ tragen Namen wie „Hold Hands“, „High Hopes“, „Let You Go“ und „Don’t Waste Time“. Es liest sich wie ein Who is Who der Szenarien zwischenmenschlicher Verbindungen und Loslösungen.

Es steckt etwas Theatralisches, übertrieben anmutendes, bei aller zu Schau gestellter Emotionalität eben auch etwas Gesteltztes in dem Gejaule. Damit beweist „High Hopes“ eine Form der Kunstsinnigkeit und Konsequenz, die eigentlich an ein Nachfolgealbum hätte denken lassen können. Das blieb aber aus. Die Band und das Label gibt es nicht mehr.
Was bleibt ist ein amtlich hinlamentiertes One-Hit-Wonder von einem Album, dessen Zauber nun zu unrecht in der Versenkung der Pop-Sümpfe funkelt.
Obgleich es genau dort, in so ein morastiges Regenwetterlicht, ganz ausgezeichnet hinpasst. Wie man es dreht und wendet: die „High Hopes“ bleiben oft unerfüllt. Umso schöner, wenn manche – wie Tarnation Street – eben doch so inbrünstig davon singen.